VHF-UHF-SDR-Transceiver
mit Raspberry Pi und HackRF
SDR-Transceiver
zum Selbstbau für Frequenzen bis ca. 50 MHz sind mittlerweile in
verschiedenen Versionen realisierbar. In diesem Artikel soll ein
SDR-Transceiver für den VHF und UHF-Frequenzbereich vorgestellt
werden. Als Hardware sind neben einem Raspberry Pi 4 (mind. 2GB RAM)
verschiedene SDR-Receiver oder Transceiver möglich. Als Receiver
sind SDR-RTL-USB-Sticks, RSP1, RSP1A usw. möglich. Der „Urvater“
der SDR-Transceiver, der HackRF One, und der Adalm Pluto können
ebenfalls verwendet werden.
D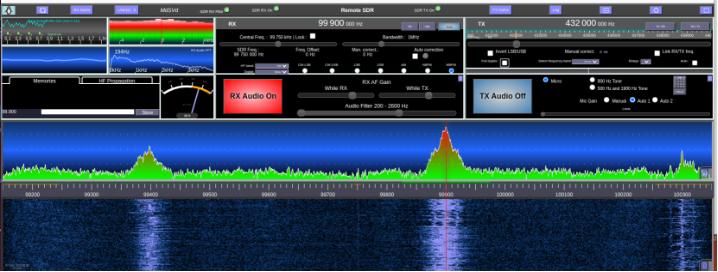 as hier vorgestellte Projekt arbeitet im Remotebetrieb, der
eigentliche Transceiver ist also über eine Netzwerkverbindung
(Kabel, WLAN oder auch Internet) an dem PC im Shack angeschlossen.
Der Zugriff erfolgt über einen normalen Internetbrowser, hier
„Chrome“ bei Linux oder „Edge“ für Windows-PCs. Als Adresse
gibt man z.B. einfach „http://192.168.178.20“, also die
IP-Adresse des Raspberry, ein. Das Konzept stammt von Andre F1ABT und
ist auf seiner Website https://f1atb.fr/ beschrieben. Dort wird auch
der Aufbau eines SDR-Transceiver für den
QO100-Satelliten beschrieben.
as hier vorgestellte Projekt arbeitet im Remotebetrieb, der
eigentliche Transceiver ist also über eine Netzwerkverbindung
(Kabel, WLAN oder auch Internet) an dem PC im Shack angeschlossen.
Der Zugriff erfolgt über einen normalen Internetbrowser, hier
„Chrome“ bei Linux oder „Edge“ für Windows-PCs. Als Adresse
gibt man z.B. einfach „http://192.168.178.20“, also die
IP-Adresse des Raspberry, ein. Das Konzept stammt von Andre F1ABT und
ist auf seiner Website https://f1atb.fr/ beschrieben. Dort wird auch
der Aufbau eines SDR-Transceiver für den
QO100-Satelliten beschrieben.
In
diesem Artikel soll der Aufbau und die Inbetriebnahme eines
Transceivers für das 2m - 23cm-Band aufgezeigt werden. Ich verwende
einen RTL-SDR-USB-Stick V3 als Empfänger und einen HackRF One als
Sender sowie eine PA mit ca. 3W Output.
Die
gewählten Module haben die folgenden Frequenzbereiche:
RTL
SDR: 30MHz – 1,7 GHz
HackRF:
1MHz - 6GHz
PA
3W: 2 – 700 MHz
Als
Alternative gibt es auch einen Wideband Amplifier auf PHA 202+ Basis
von SV1AFN, der von 60kHz – 1,7 GHz eine Ausgangsleistung von 1 W
liefert. Damit wird auch das 23cm-Band abgedeckt.
Das
Bild zeigt die prinzipielle Verschaltung der einzelnen Komponenten.
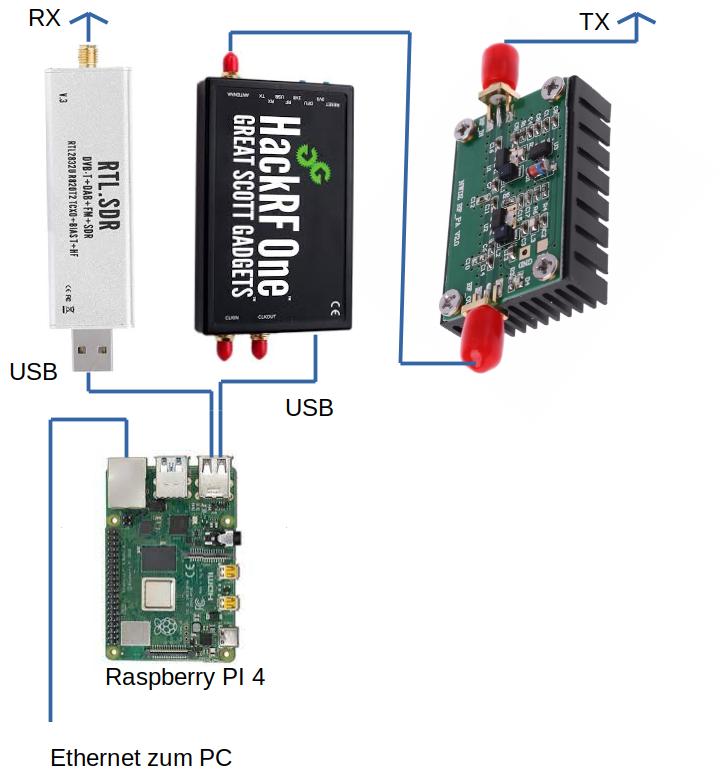
Natürlich
müssen der Raspberry Pi und die PA noch mit 5V bzw. 12V
Betriebsspannung versorgt werden. Außerdem sind zwei verschiedene
Antennen für Empfänger und Sender erforderlich. Eine Sende-
Empfangsschaltung mit einem Antennenrelais wird weiter unten
angegeben.
Ein erster Einstieg in diese Technik kann
preisgünstig auch nur mit einem RTL-SDR-USB-Stick für 30 – 40€
erfolgen. Damit ist zwar nur der Empfang im Bereich bis ca. 1,7 GHz
möglich, aber auch ein praxisnaher Test dieser Technik.
Vor
der Inbetriebnahme muss noch die Software auf dem Raspberry Pi
installiert werden. Die erforderlichen Programme findet man unter:
https://github.com/F1ATB/Remote-SDR.
Unter „Version 5.0 Releases“ findet man das für den Raspberry
Pi4 aktuellste Image. Dieses kann heruntergeladen und auf eine
SD-Card gespeichert werden. Beim Starten des Raspberrys werden dann
sämtliche erforderlichen Programme geladen und installiert, so dass
am Ende dieses Vorganges über einen Webbrowser auf den Raspberry
zugegriffen und damit der komplette SDR-Transceiver gesteuert werden
kann. Auf den Raspberry direkt kann über SSH oder VNC zugegriffen
werden.
Vorgehensweise:
Klick auf Link
https://github.com/F1ATB/Remote-SDR/releases/tag/v5.0i_rpi4.
Die
Seite: Remote
SDR v5.0 image for Raspberry 4 wird
geöffnet. Dort finden sich z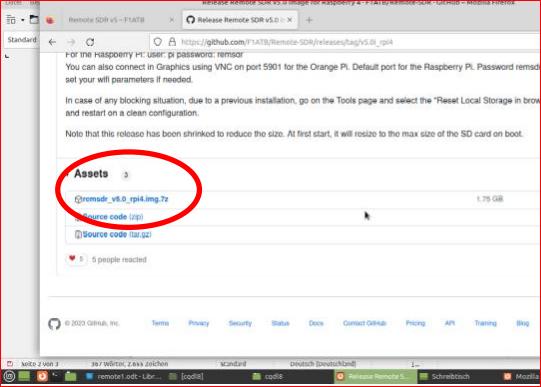
usätzliche
Hinweise.
Scrollt
man weiter nach unten, findet man den Link „remsdr_v5.0…“. Ein
Click lädt das gepackte Image (Format 7z) herunter. Dies wird in
einem Ordner
entpackt und kann dann mit einem Imager z.B. WIN32 Imager oder dem
Raspberry Pi Imager auf eine SD-Card (min. 16GB) geschrieben werden.
Mit dieser SD-Card wird der Raspberry Pi gestartet. Für den ersten
Start empfiehlt es sich, einen Monitor sowie Maus und Tastatur
anzuschließen. Ebenso sollte auch ein vorhandener SDR-Receiver und
SDR-Transceiver angeschlossen werden. Nach einigen Minuten erkennt
man den üblichen Bildschirm, durch die Eingabe von „ip a“ in
einem Terminal zeigt sich die IP-Adresse des Raspberry.
Wer
mit dem Browser „Chrome“ den Remote-SDR aufrufen will, muss in
den sog. „Flags“ eine Änderung vornehmen. Also Chrome starten,
in die Adresszeile folgendes eingeben: „chrome://flags“ und
anklicken. Es erscheint ein Fenster mit „Search Flags“, hier
eingeben: „Insecure origins treated as secure“ und die Lupe
anklicken.
D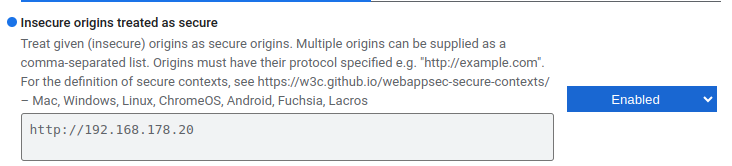
iese
Einstellung gibt an, wie unsichere Quellen behandelt werden. In das
grau unterlegte Feld gibt man die Adresse des Remote-Rechners, also
hier 192.168.178.20 ein, d.h. nur die unsicheren Daten dieses
Rechners werden verarbeitet. Der rechte Button zeigt vorher
„Disabled“ an, durch Anklicken wird er auf „Enabled“
umgestellt. Ein Neustart von Chrome speichert diese Einstellungen.
Der
Aufruf durch den Browser http://IP-Adresse
sollte nach einigen Sekunden das folgende Bild zeigen.
D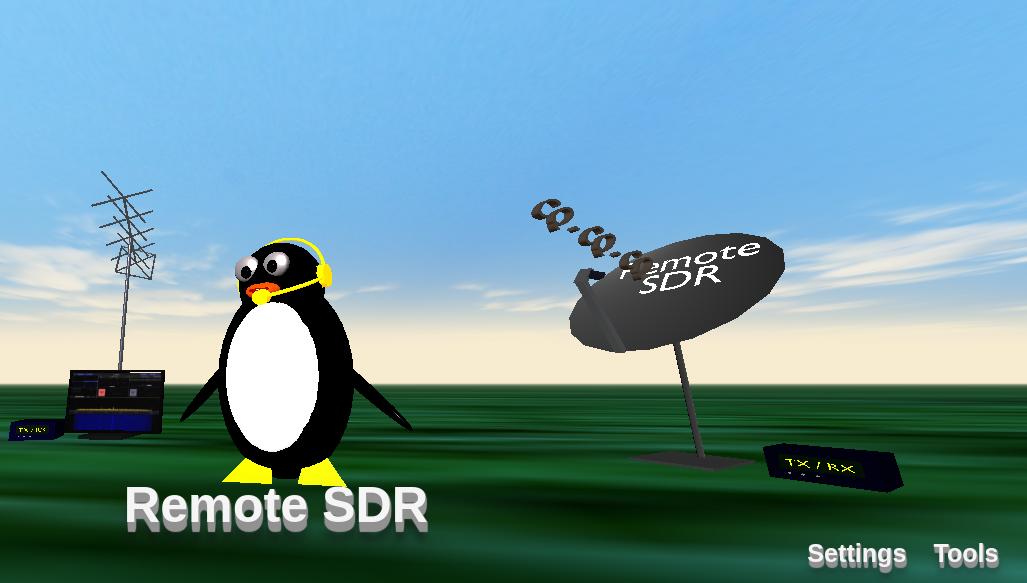
urch
Anklicken des Textes „Remote SDR“ wird der webbasierte
Transceiver gestartet. Vorher müssen aber in „Settings“ die
Grundeinstellungen evtl korrigiert werden.
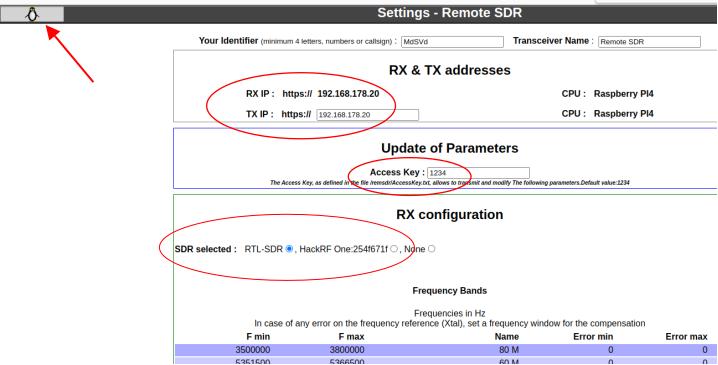
Die
IP-Adresse des TX muss eingegeben werden, sie ist normal gleich der
des RX. Ein Zugangskey ist erforderlich, es genügt der Defaultwert.
Der als RX verwendete SDR wurde erkannt und muss ausgewählt werden.
Weiter unter werden dann die Empfangsfrequenzbereiche angezeigt,
diese können auch geändert werden. Auf die Belegung der
GPIO-Anschlüsse gehe ich später ein. Dann folgt die
TX-Konfiguration.
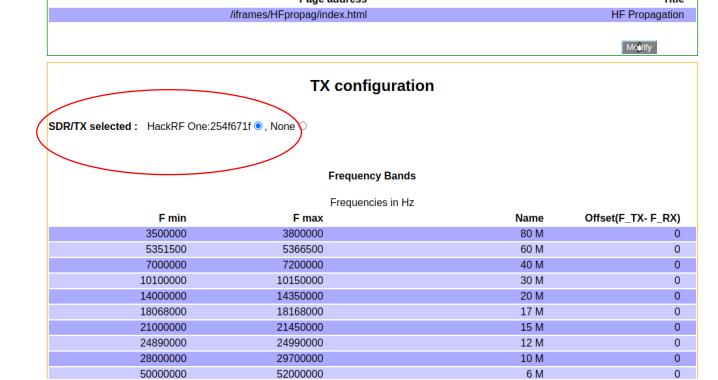
Der
HackRF One wurde erkannt und kann durch Anklicken als TX verwendet
werden.
Damit
ist die Grundkonfiguration abgeschlossen. Durch Klick auf den
„Pinguin“ links oben (siehe Bild RX-Konfiguration) gelangt man
auf den Startbildschirm.
Im
Bereich „Tools“ finden sich noch einige nützliche Werkzeuge (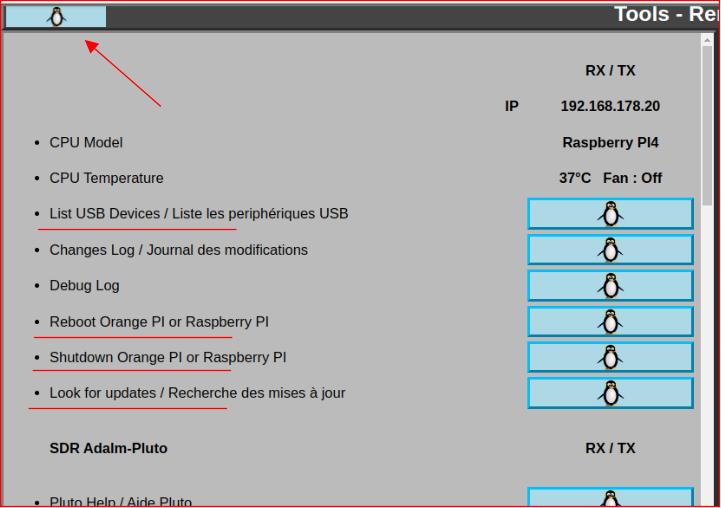 Hilfsprogramme).
Hilfsprogramme).
Die
markierten Tools erklären sich eigentlich von selbst. Das letzte
Tools sucht nach Updates und installiert diese. Aufgerufen werden
diese Tools durch Klick a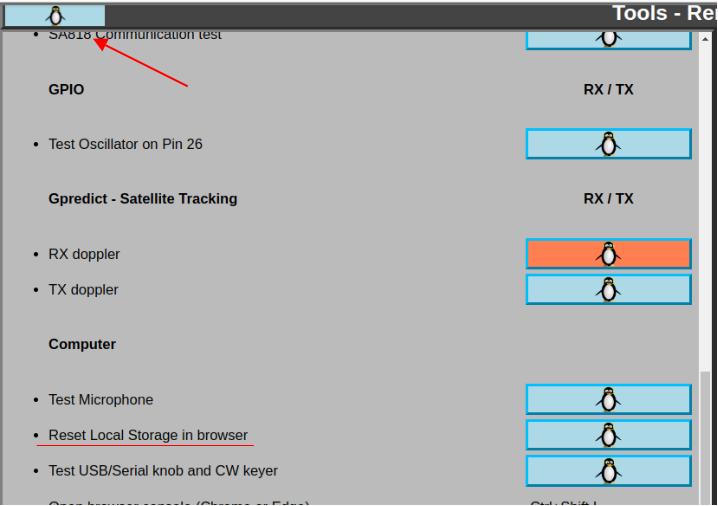 uf den jeweils rechten „Pinguin“. Weiter unten finden sich noch
einige Werkzeuge für die verschiedenen SDR-Geräte und für den
Stations-PC.
uf den jeweils rechten „Pinguin“. Weiter unten finden sich noch
einige Werkzeuge für die verschiedenen SDR-Geräte und für den
Stations-PC.
Das
markierte Tool „Reset Local Storage…“ ist recht hilfreich, wenn
der Browser auf dem Stations-PC mal „aussteigt“. Der Cache wird
damit gelöscht und der Browser fängt von vorne an.
Home
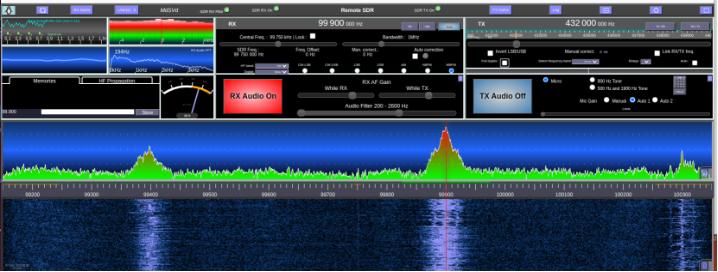 as hier vorgestellte Projekt arbeitet im Remotebetrieb, der
eigentliche Transceiver ist also über eine Netzwerkverbindung
(Kabel, WLAN oder auch Internet) an dem PC im Shack angeschlossen.
Der Zugriff erfolgt über einen normalen Internetbrowser, hier
„Chrome“ bei Linux oder „Edge“ für Windows-PCs. Als Adresse
gibt man z.B. einfach „http://192.168.178.20“, also die
IP-Adresse des Raspberry, ein. Das Konzept stammt von Andre F1ABT und
ist auf seiner Website https://f1atb.fr/ beschrieben. Dort wird auch
der Aufbau eines SDR-Transceiver für den
QO100-Satelliten beschrieben.
as hier vorgestellte Projekt arbeitet im Remotebetrieb, der
eigentliche Transceiver ist also über eine Netzwerkverbindung
(Kabel, WLAN oder auch Internet) an dem PC im Shack angeschlossen.
Der Zugriff erfolgt über einen normalen Internetbrowser, hier
„Chrome“ bei Linux oder „Edge“ für Windows-PCs. Als Adresse
gibt man z.B. einfach „http://192.168.178.20“, also die
IP-Adresse des Raspberry, ein. Das Konzept stammt von Andre F1ABT und
ist auf seiner Website https://f1atb.fr/ beschrieben. Dort wird auch
der Aufbau eines SDR-Transceiver für den
QO100-Satelliten beschrieben.
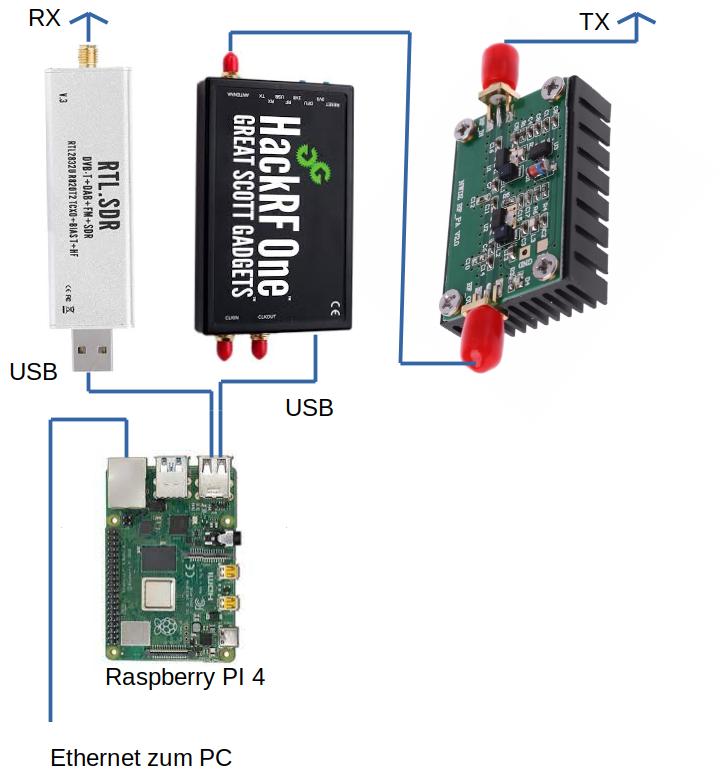
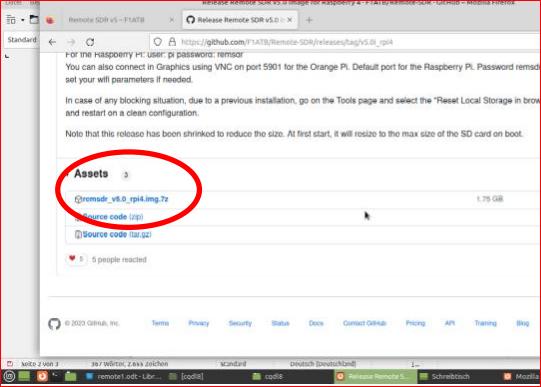
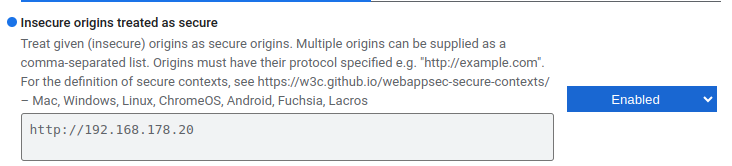
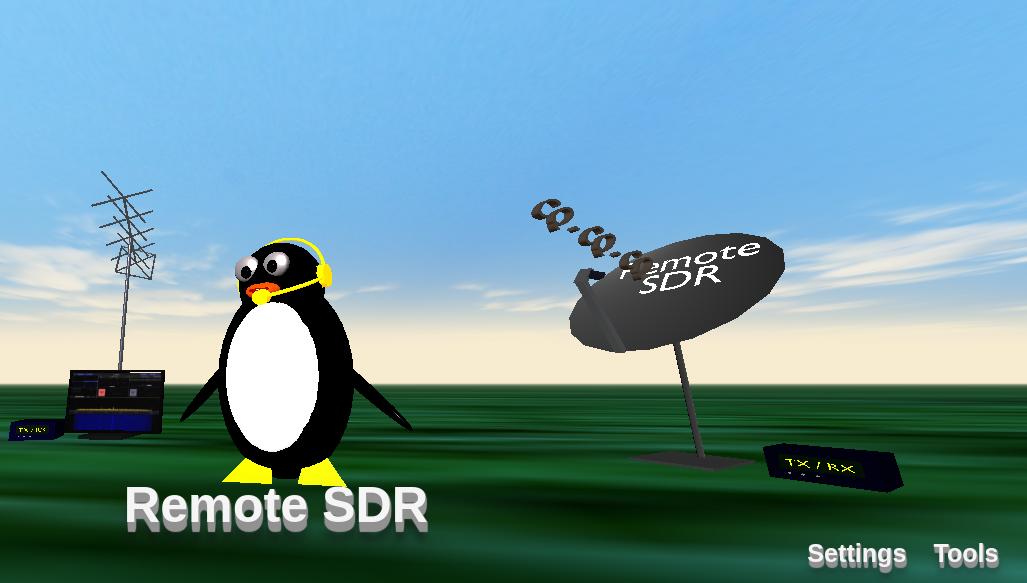
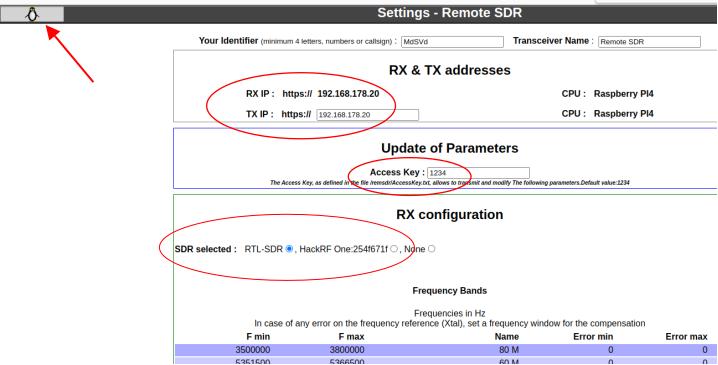
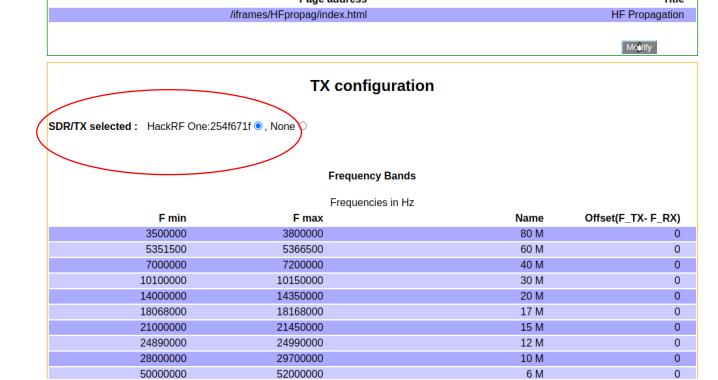
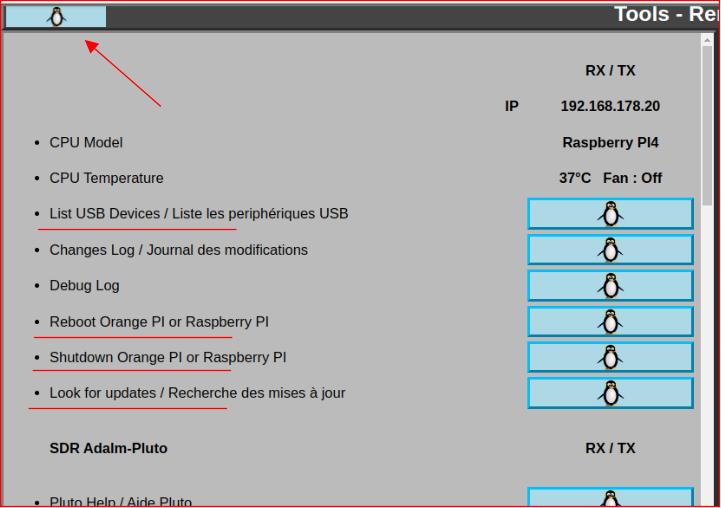 Hilfsprogramme).
Hilfsprogramme). 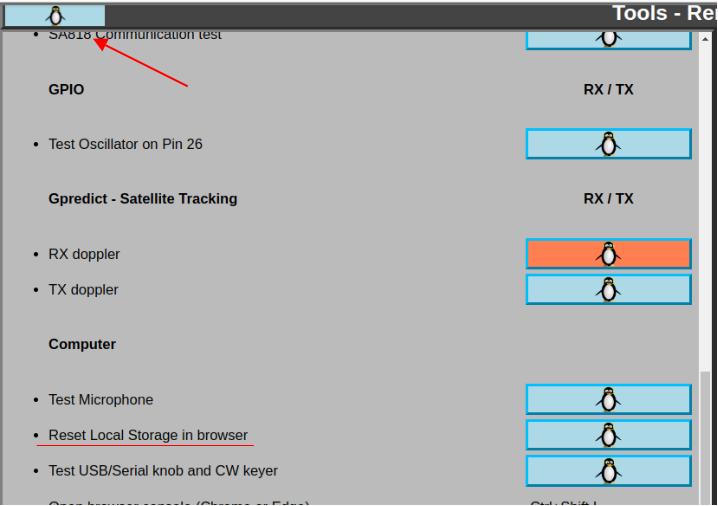 uf den jeweils rechten „Pinguin“. Weiter unten finden sich noch
einige Werkzeuge für die verschiedenen SDR-Geräte und für den
Stations-PC.
uf den jeweils rechten „Pinguin“. Weiter unten finden sich noch
einige Werkzeuge für die verschiedenen SDR-Geräte und für den
Stations-PC.